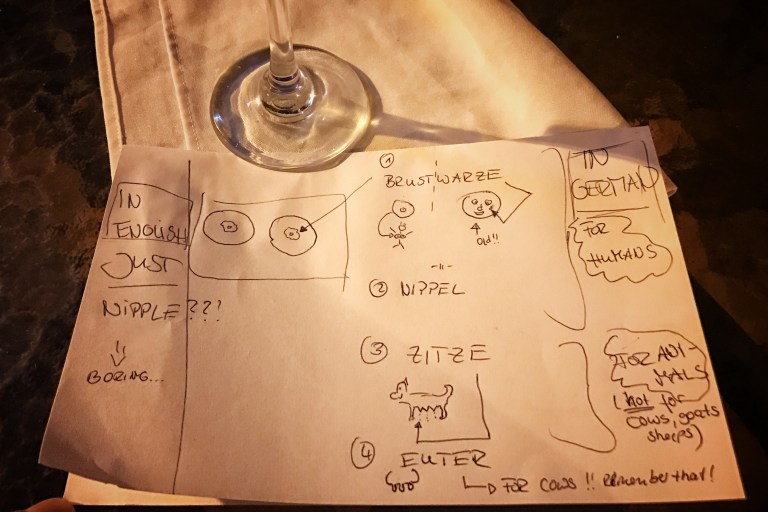In Santa Marta habe ich Jesus aus Orlando wiedergetroffen – meine Reisebekanntschaft aus Nicaragua. Es wartete ein großer Abenteuerspielplatz in den Sierra Nevada Mountains in Nordkolumbien auf uns: Der 4-tägige und 46km lange Trek zur Lost City – eine verlorene, prähistorische Stadt im tiefsten Dschungel von Kolumbien mit dem ursprünglichen Namen “Teyuna”.
Von Santa Marta sind wir am nächsten Tag mit einem Jeep erstmal zwei Stunden off-road in die Berge gefahren. Und dann ging es los! Nach einer Reis und Bohnen-Leckerei (Ah!) zum Lunch haben wir uns die ersten 2h bergauf durch die brutale Mittagshitze von einer Fruit-Station zur Nächsten geschleppt. Hier gab es als Energizer Cocablätter zum Kauen und Orangen zum Auslutschen. Auf dem Weg begegneten uns immer wieder nach Atem ringende, vollgepackte Maultiere. Getreu ihrer bürgerlichen Existenz als Nutztiere sind Mules hier quasi die Schwerlasttransporte auf kolumbianischen Autobahnen und ein stets verführbares Opfer, um einige vom Trek geschundene Wanderer abzutransportieren. Beneiden tue ich die Vierbeiner nicht, trotzdem müssen sie mich nicht brutal den Abhang runterstoßen. Unbeeindruckt davon ging es weitere 2h an umwerfenden Panoramaaussichten auf dschungelbewaldete Bergabhänge vorbei (früher zum Teil alles Coca-Plantagen zur Herstellung von Kokain) bis wir schließlich das erste Camp erreicht haben. Hier mauserte sich ein kleiner Bachlauf mit Wasserfall als entzückendes Plätzchen, um all den Dreck und Schweiß vom Tag den Fischen im Wasser zu überlassen. Diese waren nämlich äußerst gierig und haben an uns geknappert wie die bemitleidenswerten Fische aus Bangkok, die an der Hornhaut dickbäuchiger Europäer in unwürdigen Wasserschalenbecken nagen. Noch einen frischen Fisch zum Dinner und ein paar Shots Aquadiente (ein typisch kolumbianischer Schnaps) und schon ging es erschöpft auf unsere Freiluftmatratze.
Unsere Gruppe bestand aus 16 Leuten: Eine chilenische Familie bestehend aus Mutter, Vater und Kind (!), 2 Kolumbianer, 2 Argentinier, 1 Ire, 1 Niederländer, 1 Französin, 4 Süddeutsche, Jesus aus den Staaten und ich als mittelständische Hamburgerin. Eine angenehme, ruhige Gruppe – für meinen Geschmack allerdings zu viele Deutsche (ich will meiner eigenen Rasse nicht ständig im Ausland begegnen!) und zu viele, die kein Englisch sprachen. Außerhalb meiner Filterblase befanden sich auf dem Trek noch 4 weitere Gruppen á 15-16 Leute. In einigen davon waren ausgesprochen unangenehme, junge Franzosen und Deutsche. Zwei verhaltensauffällige, unrasierte Französinnen waren mir als kritischer Beobachter dabei ein besonderer Dorn im Auge: Zwei hyperaktive Meteoriten der Schamlosigkeit stürzten auf die Sierra Nevada ein und erzeugten einen Kreisch-Tornado nach dem nächsten. Mein Minimalziel auf dem Trek war es, diese kettenrauchenden Reptillengesichter so gut es geht zu meiden – was schwer war, da man sich immer mal wieder auf dem Trail oder in irgendwelchen Camps begegnete.
Der zweite Tag hatte es in sich. Anfangs noch hoch motiviert und stimuliert durch die mystische Dschungellandschaft, wurde der Körper von Hügel zu Hügel schwächer und fühlte sich am Ende wie eine vom Krieg gezeichnete, Hüft- und Knieproblem geplagte Großmutter an. Der Rückbau meines Körpers hatte begonnen. Dabei fing alles so romantisch an: Stundenlang sind wir an endlosen Flussläufen und durch indigene Dörfer vor uns hin gewandert. Dann ging es nach einiger Zeit tiefer in den Dschungel und immer weiter bergauf. Die Fruit-Stationen wurden weniger, der Schweiß und das Keuchen mehr. Dabei kreuzten wir viele Male den Fluss, teilweise sogar knietief. Zwischendurch erreichen wir aber eines meiner persönlichen Highlights: Ein Flusslauf mit Stromschnellen, kleinen Wasserfällen, riesigen Steinen zum Sonnenbaden, Kliffs zum runterspringen – eingerahmt in eine idyllische Dschungelszenerie und tausenden von Schmetterlingen: Der ideale Platz um sich von den Strapatzen zu erholen. Nach 9 kräfteraubenen Stunden Hiking in brühender Hitze haben wir es dann endlich ins Camp 2 geschafft, in dem diesmal – im Gegensatz zur ersten Nacht – alle Gruppem untergebracht waren.
Hier wurde Jesus und mir dann die frohe Botschaft von Miller, unserem Guide, unfrittiert aufgetischt: Es gab keine Matratzen mehr! Da Jesus und ich noch irgendwelchen Eidechsen hinterhergejagt sind und dadurch später im Camp eintrafen, wurden wir unverdiente Opfer von Matrazen-Klau. Und wer mitten drin? Meine Lieblingsfranzosen mit Penetranzpräsenz. Es gab schlichtweg zu wenig Betten für die Fülle an Menschen. Strafverschärfend kommt hinzu, dass eine Gruppe, die eigentlich nur Hammocks reserviert hatte, sich kurzerhand unsere Matratzen unter den Nagel gerissen hat. Ich habe es mir und anderen erspart, wie ein Platzwart durch die Gegend zu rennen und nachzufragen, ob das Bett auch den rechtmäßigen Besitzer ehrt. Das ist dann noch würdeloser, als in einer von Wanzen verfressenen Hängematte mitten im kalten Dschungel zu erfrieren. Obwohl es durchaus reizvoll gewesen wäre die Franzosen, die sich wiederrechtlich auf meinen Traveller-Thron gesetzt haben, mit einer strengen Ermahnung des Platzes zu verweisen. Jesus und ich mussten uns also mit einer gealterten Hängematte irgendwo am Fluss im tiefen Dschungel zufrieden geben. Fair enough! Was aber wirklich wunderlich war: Wirklich keiner der Jungs aus unserer Gruppe ist auch nur einmal kurz auf die Idee gekommen (noch nicht mal scheinheilig) mir als Frau sein Bett zum Tausch gegen die Hängematte anzubieten. Alles Eiskönige mit einem Herz aus Magnum-Eis. Eine saubere Toilette in diesem Camp zu finden war im Übrigen in etwa so ergebnisreich wie auf dem Kopf von Thorsten Legart Haare zu finden. Das Toilettenpapier – so leer wie die Gesichter der Französinnen. Hygiene wird von den Verantwortlichen und Trekkern gleichermaßen für eine unbedingt meidbare Krankheit gehalten. Nein danke, ich piss lieber in den Dschungel! Die Mängelliste in Camp 2 ist angesichts meines körperlichen Zerfalls lang. Das Camp war schlechter organisiert als die Elfenbeinküste und der Sudan zusammen.
Gegen Abend kehrte meine Ausgeglichenheit mit dem Angriff der Killer-Fliegen zurück. Sie waren überall: Kleine schwarze, mir artfremde Fliegen. Überall! Die Luft war schwarz – so schwarz wie sich alle Gruppen über die Viecher ärgerten und mein Humor. Das Ärgernis der anderen. Beruhigend für mich. Unsere Gruppe nahm die Situation aber gelassen und knapperte fleißig am Hähnchenschenkel, auf dem sich bereits ein Schichtkohl Fliegen befand. Später kam Johnny dazu, ein angenehmer Neuseeländer aus einer anderen Gruppe, welchen wir tags zuvor bereits in unserem Hostel kennengelernt haben. Zusammen tranken wir uns die allseits auf dem Trek beliebten Französinnen und ihren grauenvollen Akzent (der bei englischsprechenden Franzosen serienmäßig immer mit dabei zu sein scheint) mit Aquadiente schön.
Die Nacht war kurz und unkomfortabel. Nach dem 9-stündigen Hike wussten meine Beine nicht so recht was mit der Hängematten-Situation anzufangen. Mittlerweile ist meine Haut durch das ganze Moskitospray (100% DEET!!!) auch zur Eidechsenhaut mutiert. Sei es drum! Heute war der Tag, an dem wir die Lost City endlich erreichen werden. Völlig aufgeputscht vom wenigen Schlaf und einer unbremsbaren Motivation, die Stätte als erste Gruppe vor allen anderen zu erreichen, ging es bereits um 5:00 morgens los. Der Dschungel war noch in Dunkelheit gehüllt, was den finalen Trek zur Lost City zusätzlich erschwerte. Nach einer weiteren Flussüberquerung erreichten wir dann die erste von 1.200 Treppen zu den Terassen. Begleitet wurden wir die ganze Zeit von Simba, einem kleinen (Löwen-)Welpen, der irgendwo auf dem Trek aus dem Geäst gerannt kam und uns von nun an auf Schritt und Tritt folgte. Die Treppen hatten es in sich – aber je höher wir kamen, desto mehr wollte ich die Erste auf der höchsten Terasse sein. Und so wurde ich immer schneller und schneller, überholte alle anderen aus meiner Gruppe, rannte fast schon meditativ und war am Ende mit etlichen Minuten Vorsprung die Erste von rund 100 Trekkern, die die Lost City an diesem Tag betreten hat. Keine Ahnung wo auf einmal die Motivation oder Energie herkam, aber seitdem bin ich unbesiegbar.
Die Lost City wurde vom Volk der Tayronas zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert als Hauptstadt und spirituelles Zentrum erbaut – Noch lange bevor die Inkas den Machu Picchu in Peru errichtet haben. Im 16. Jahrhundert kamen spanische Kolonisten in die Region. Die Tayronas verließen die Stadt und zogen sich lieber tief in den Dschungel zurück, als dass sie ihre Stadt in spanische Hände fallen lassen würden. Über mehrere hundert Jahre hat sich der Dschungel die verlassene Stadt zurückgeholt. Nur der Shamane der vier indigenen Gruppen in diesem Gebiet war sich der Existenz dieser Stadt bewusst und besuchte die Lost City regelmäßig, um heilige Zeremonien abzuhalten. In den frühen 1970ern wurde die City dann zum ersten Mal von der Außenwelt entdeckt. Leider sind die Falschen auf sie gestoßen: Organisierte Grabdiebe nahmen all das Gold, die wertvollen Handarbeiten und die alltäglichen Gegenstände. Hinzu kommt, dass keine geschriebenen Nachlässe existieren, sodass alles was das Volk der Tayronas betrifft reine Spekulation ist. Die Holzhäuser der Tayronas sind lange dahin. Geblieben sind die guterhaltenen Treppen und die mystisch bewachsenen 170 Stein-Terrassen, von denen die meisten als Fundament für Häuser oder spirituelle Rituale dienten. Die Wiwa, Kogi, Arthuaco and Kankuamo sind die indigenen Nachfahren der Tayronas und versuchen heute noch die Geschichten und Traditionen ihrer Vorfahren zu bewahren. Die indigenen Völker pflegen zudem eine intensive Verbindung zur Natur. Sie kleiden sich in einem weißen Leinengewand, was für sie Reinheit und die Vollkommenheit der schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada symbolisiert. Sie gehen meist barfuß, um eins mit der Erde zu sein. Immer wieder sind wir den Kogis begegnet, wodurch der Trek nicht nur eine landschaftlich umwerfende, historisch wertvolle und körperlich anspruchsvolle Intensität bekommen hatte, sondern vor allem immer wieder auch kulturell interessante Einblicke bot.
Ein typischer Brauch ist die Poporo, welche von den indigenen Männern zum rituellen Konsum von Coca genutzt wird. Generell werden ja die aktiven Alkaloide in den Cocablättern extrahiert und chemisch zu Kokain verarbeitet, das dann meistens geschnupft wird – die Wirkung ist allseits bekannt. Die Blätter an sich zu kauen, hat allerdings kaum Effekte außer einen gutgemeinten, aber kaum merkbaren Energieschub. Für die Poporo werden Muschelschalen (Caracucha) über einen Feuer geröstet und dann als feines Pulver zerkleinert, welches dann in einen ausgehöhlten Flaschenkürbis (Totuma) gefüllt wird. Männer ab 30 Jahren nehmen dann ein Büschel Cocablätter in den Mund und tauchen einen kleinen Stab in die Pulvermasse ihrer Totuma, um ein bisschen von der Muschelschalen-Mixture herauszuziehen und abzuschlecken. Ihr Speichel und der Rest Pulvermix werden mit dem Stick außerhalb der Totuma abgewischt. Dadurch entstehen Ablagerungen und die Totuma wird über die Zeit immer breiter. Gleiche ästhetisch fragwürdige Ablagerungen kann man auch auf den Zähnen und Lippen der Männer beobachten. No french kisses, please! Dieser Wachstumsprozess der Totuma symbolisiert jedenfalls Weisheit – Je grösser die Totuma wird, desto weiser der Kerl. Die Herren kauen das Muschelschalenpulver und die Cocablätter, dessen Kombination die eigentliche Wirkung der Cocablätter vervielfacht, bis zu 30min, um alle aktiven Komponenten freizulassen, die sie in einen abgeschwächten kokainähnlichen Rausch versetzen.
Nachdem wir uns einen halben Tag in der Lost City aufgehalten haben und die einzigartige, magische Kulisse genossen, ging es innerhalb von zwei weiteren Trekking-Tagen und einer Nacht im Wiwa-Camp wieder zurück in Richtung Santa Marta. Gerade der letzte Teil war fürchterlich anstrengend, da hier kaum mehr schattiger Dschungel zu finden war und die Sonne uns geschmolzen hat. Schmerzverschärfend kam hinzu, dass ich mir bei meinem übermütigen (aber ruhmreichen) Run die Treppen der Lost City hinauf das Knie kaputt gemacht hatte und ich nur noch unter starken Schmerzmitteln gehen konnte. Viele Leute stufen den Trek als anspruchsvoll ein. Zwei, drei Trekker aus den Gruppen mussten aus Erschöpfung auch einige Teile der Strecke auf einen Esel umsteigen, aber ich würde den Trek eher als mittelschwierig einstufen. Das wirklich anstrengendste sind die stellenweise sehr steilen Aufstiege bei intensiver Hitze.
Die letzten Schritte zurück zu dem Lokal, in dem wir vor 4 Tagen mein Lieblingsessen gegessen haben und gestartet sind, waren wie ein griechischer Siegeszug durch das Volk nach Einnahme einer neuen Stadt. Hier haben wir nochmal einen frischen Fisch gemampft bis wir dann völlig erschöpft zwei 2h mit dem Jeep auf holprigen Pfad zurück nach Santa Marta gefahren sind. Nach unserer hinreichenden Belohnung mit westlichen Essen und argentinischen Wein in einem exklusiven Restaurant haben Jesus und ich abends noch ein paar Leute aus unserer Truppe auf ein paar Drinks getroffen. Alkoholseelig und stolz wurde nochmal jeder Schritt des Treks mit Aquadiente bis in die Nacht hinein ausgiebig begossen.
PS: Ich muss gestehen, dass ich eine kleine Prinzessin auf dem Trek war. Nachdem direkt das erste Essen nicht gerade verheißungsvoll mit Reis und Bohnen begonnen hatte, habe ich Rot gesehen. Keine weiteren Reis und Bohnen-Breakdowns, bitte! Kurzerhand habe ich Miller gefragt, ob Sandra, unsere bezaubernde Köchin, alternativ für mich ab und an auch ein paar Kartoffeln oder Blumenkohl anstatt von Reis und Linsen anstatt von Bohnen aus dem Hut zaubern kann. Ich war glückbeseelt: Meine Wünsche wurden erfüllt. Und schon bald hat Miller auch gelernt, dass ich ohne einen Salzstreuer auf dem Tisch in tiefe Trauer verfalle. Mein weißes Lieblings-Accessoire war nach dem ersten Tag bereits das erste was vor meine Nase gestellt wurde. Noch vor dem Besteck.